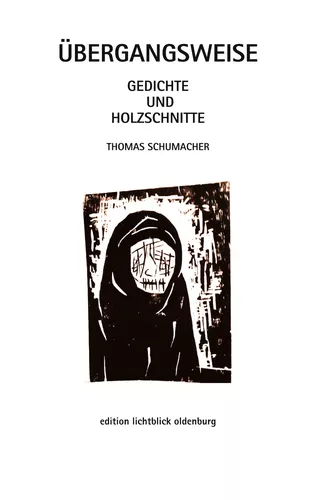Renate Schildmann
UNTERWEGS IN NORWEGEN
AQUARELL - FOTOGRAFIE - GRAFIK
Dieser Katalog wurde aus Anlass der Ausstellung
Renate und Michael Schildmann
„Das Licht des Nordens“
Aquarellmalerei und Fotografie aus Norwegen
vom 8. November 2026 - 2. Januar 2027
im Künstlerhaus Hooksiel
zusammengestellt.
____________________21 x21 cm, 68 Seiten, Softcover___________________
ISBN-Nr: 978-3-9826832-4
edition lichtblick, oldenburg
15,00€
Bestellbar in jeder Buchhandlung
oder auf Rechnung über
edition-lichtblick-oldenburg@ewetel.net